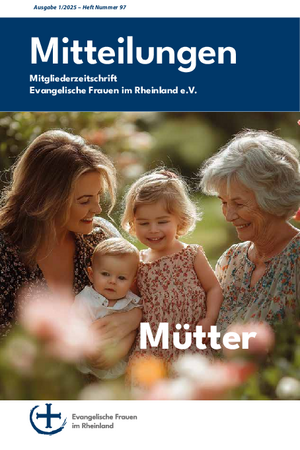Alle Menschen haben eine Mutter. Wir wachsen im Mutterleib heran und werden von unserer Mutter geboren. Viele von uns haben Liebe und Fürsorge durch ihre Mutter erlebt. Andere haben schlechte Erfahrungen gemacht und mussten lange kämpfen, um unabhängig zu werden und den Schmerz zu überwinden.
Nicht alle von uns sind Mütter, aber wir alle kennen kleine und große Kinder, denen unsere Unterstützung, unsere Freundlichkeit und Geduld, unsere Zuwendung, Wärme und Fürsorge guttun. So wirken wir mütterlich in diese Welt.
Natürlich ist das ein Idealbild von Mütterlichkeit, vielleicht auch ein Klischee. Sehr wirklich und konkret sind allerdings die Bedürfnisse, die damit verbunden sind: Wir brauchen Schutz und Geborgenheit, Liebe und Angenommensein.
Mit diesen Bedürfnissen kommen wir zu Gott.
Dankbar erkennen wir, dass Gott, Mutter alles Lebendigen, uns das Leben geschenkt hat und uns nährt und erhält.
Wir sind Kinder Gottes und erbitten von Gott, unsere Bedürfnisse zu stillen, ohne dass wir eine Gegenleistung bringen können. Wir sind ganz auf das Erbarmen Gottes angewiesen, wie ein Kind auf die Mutter angewiesen ist.
Warum sprechen wir trotzdem so viel öfter von Gott als Vater und Herr? Warum beten wir nicht „Mutter unser“? Bilder und Traditionen haben uns über Jahrhunderte dahin gebracht, uns Gott als Mann vorzustellen – genauer gesagt als alten weißen Mann mit langem Bart. Das ist ganz und gar unbiblisch: Denn Gott sagt durch den Propheten Hosea „Gott bin ich, und nicht ein Mann“ (11,9) und immer wieder warnt die Bibel davor, sich ein Bild von Gott zu machen, zum Beispiel in den 10 Geboten.
Deshalb haben die biblischen Schriften eine spannende Lösung, wenn sie von Gott sprechen: Einerseits ist der Eigenname Gottes so heilig, dass er nicht ausgesprochen wird. Und andererseits gebrauchen die biblischen Texte eine Vielzahl von Bildern für Gott. So kommt niemand auf die Idee, eins der vielen Sprachbilder mit Gott selbst zu verwechseln.
Ein starkes und schönes Bild für Gott ist das der Mutter: Beim Propheten Hosea wird Gott als Bärin und Löwin beschrieben, die ihre Kinder umsorgt und schützt (13,8), bei Matthäus ist Gott wie eine Vogelmutter, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt (23,37), und Paulus spricht davon, dass die ganze Schöpfung in Geburtswehen liegt, bis wir als Kinder Gottes angenommen werden (Röm 8,22).
Wie wir uns Gott vorstellen, ist sehr persönlich. Es ist sicher ganz verschieden, wie wir beten und unseren Glauben ausdrücken. Für manche ist es heilsam und befreiend, die männliche und oft kriegerische Sprache der Tradition hinter sich zu lassen. Sie beginnen Gebete zum Beispiel mit Worten wie „Gott, Du Ewige, Du Schöpferin, Mutter für mich“. Und manche merken, dass es zu ihrem Glauben gut passt, wenn sie Gott als Licht und Kraft, als Quelle und Trost denken.
Wenn wir die Vielfalt der biblischen Bilder nutzen, dann machen wir es wie unsere Mütter und Väter im Glauben, die die biblischen Texte verfasst haben: Wir vermeiden es, Gott auf ein Bild festzulegen.
Früher habe ich beim Beten den Blick auf meine gefalteten Hände gesenkt oder die Augen geschlossen. So hatte ich es gelernt und so konnte ich zur Ruhe kommen. Heute richte ich, wenn es möglich ist, meinen Blick beim Gebet gerne aus dem Fenster in die Natur. Vielleicht sehe ich einen Baum, der gerade anfängt zu blühen. Oder ich sehe Wolken, die sich in verschiedenen Grautönen auftürmen. Ich sehe Mutter Natur ins Antlitz. Und dahinter erahne ich Gott, Mutter für uns, erschaffende Kraft, Quelle alles Lebendigen.
Wenn Sie mögen, probieren Sie es aus: Versuchen Sie Gott mit ungewohnten Worten anzureden. Was verändert sich? Komme ich anders vor? Erlaube ich mir andere Gefühle, wenn ich bete: Mutter unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name?
Meine Lippen sprechen mit: Vater unser im Himmel… Mein Herz ergänzt: Gott, Mutter für uns, in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Du bist mir nah. Amen.
Irene Diller
Stabsstelle Vielfalt und Gender Evangelische Kirche im Rheinland
(in: Mitteilungen 1/2025, Mitgliederzeitschrift Evangelische Frauen im Rheinland e.V.)